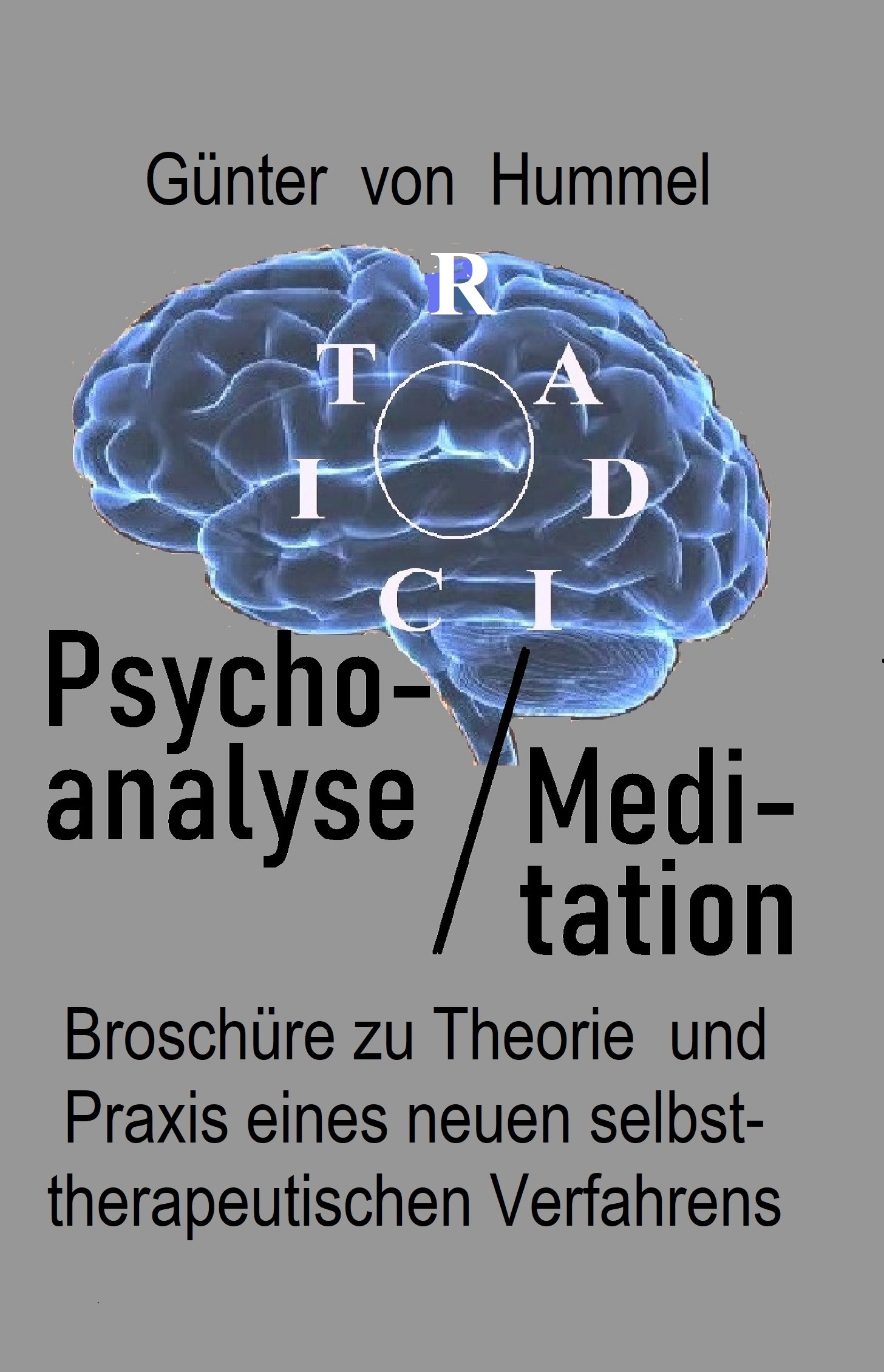Am Anfang ist die Trauer. Es ist nicht die Kraft, die Tat oder das Wort, wie es Goethe im Faust durchspielt und wie es – was das Wort angeht – zu Beginn des Johannesevangeliums steht. Es ist die Trauer, die den Anfang macht und zwar nicht eine bestimmte Trauer wie etwa die Trauer um den Verlust des Paradieses oder - wie es die Psychoanalytiker sagen – um den Verlust des mütterlichen Objekts. Das Kleinkind erfasst nicht die Mutter als reifes Subjekt, sondern als etwas von ihr, einen bestimmten Zug von ihr, der ihm notwendig erscheint. Doch die Trauer als solche hat keinen bestimmten Grund oder scheint keinen zu haben. Die Freudschülerin Melanie Klein sprach diesbezüglich von einer depressiven Phase im Leben des Kindes, die sozusagen für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist. Aber die Trauer ist ja keine Depression, ein Begriff, der zu klinisch klingt. Der Philosoph M. Heidegger würde sagen, dass die Trauer das „In-die-Welt-Geworfensein“ ist, das dann, wie er hervorhebt, in die „Sorge ums Dasein“ mündet.
Nein, die Trauer ist der Anfang und als solche drängt sie sich zu entäußern, Tränen zu produzie-ren und den Blick ernst werden zu lassen. Die Trauer ist eine existenzielle Grundverfassung, die bewusst macht, dass trotz ihrer Anwesenheit noch etwas da ist: die Luft zum Atmen, der Schleier der Welt, die Verborgenheit des Eros. Das alles bleibt immer so: wir sind die, als die wir atmen, als die wir hinter dem Schleier die Farben der Dinge sehen und in der Verborgenheit des Eros uns selbst verbergen. Die Trauer ist eine große Verwobenheit und sie macht uns nicht sichtbar, nicht äußerlich traurig. Sie ist nicht oder nur für Momente ein Gefühl des Traurigseins. Die Trauer wie ich sie hier verstehe, hat kein Objekt. Sie ist Trauer per se.
Der Psychoanalytiker J. Lacan, der die Mathematik und die Geometrie liebte, sagte immer, dass am Anfang der Mangel, die Kluft, das Loch, die Lücke ist. Wir bemerken diese Lücke nicht oder nur kaum, denn wie soll man eine Lücke bemerken, wenn sonst nichts da ist. Natürlich ist etwas da und Lacan meinte dann, es sei eben der Rand der Lücke oder des Lochs, der letztlich doch irgendwie spürbar da ist. Mit dem Rand spielte er auf die Ränder der Körperöffnungen an, die eine entscheidende Rolle spielen, weil sich an ihnen der Trieb, der Eros, das Begehren manifes-tiert. Und so glauben wir durch das Spiel mit den Rändern die Trauer vergessen zu können. Die Ränder wölben und krümmen sich, so dass sich an ihnen Wülste und Einkerbungen ergeben, Saugspiele, Pupillenlüste und ganze melodramatische Gedankenverkettungen. Auch das Denken ist nichts anderes als ein aufgehübschter Rand. Deswegen denke ich jetzt nicht, sondern schreibe einfach nur.
Aber auch das Schreiben wird ein Ende haben und damit die Trauer dabei nicht zur Melancholie wird, habe ich ein Schreiben in Kreisform entwickelt, in der sich die Buchstaben oder – wenn man unbedingt will – die Semanteme oder Ähnliches so verknoten, so kreisförmig gezirkelt ha-ben, dass sie aus einer Formulierung mehrere Bedeutungen herauslesen lassen. Sie können die Trauer sichtbar machen, ohne dass man ihr verfallen muss. Schließlich kann man sich ja nicht auf eine beliebige Bedeutung in diesem Kreis festlegen, sich nicht an ein bestimmtes Semantem klammern, sondern muss einsehen, dass eben mehrere Bedeutungen ineinandergeschachtelt da-stehen, alle unterschiedlich, alle disparat genug, so dass sich kein vordergründiger Sinn ergeben kann. Denn ein solcher würde uns zu heftig trauen lassen. Dagegen ist die Trauer also solche ja nichts Schlechtes.
Ich habe in meinen Veröffentlichungen viele derartige Kreisformulierungen, die ich auch Formel-Worte genannt habe, aufgeführt und ihre Einzelheiten beschrieben und stelle deswegen hier jetzt nicht extra eine solche Schreibung vor. Hier will ich mehr darauf hinweisen, dass man – ist man sich der Trauer als des Anfangs von allem bewusst – mit dem wiederholten durchdenken der reinen Lautformulierung (da man ja keine einzelne Bedeutung herausfiltern kann und soll) den allerletztlichen Sinn des Ganzen aus sich selbst heraus entwickeln kann und soll. Können und Sollen. In meinen Veröffentlichungen habe ich diesen Vorgang als Meditation bezeichnet. Doch dies ist nicht notwendig. Meditation klingt gleich so nach religiöser Verhaftung, nach zu ernster, zu stiller Wegtretung. Warum sollen einem nicht ein paar Tränen kommen und ein leicht ernst-haftes Gefühl entstehen, das den Blick einfältig macht. Einfalt ist nicht grundsätzlich etwas ganz Falsches.
Ich beginne vor vorne: Am Anfang ist die Trauer, etymologisch herkommend von ‚dreu’, brö-ckelnd und man denkt vielleicht auch an trauen und die somit unendlichen Zusammenhänge die-ser Worte, die wie ein weitgespanntes Netz aus hausdünnen Fäden sind. Moderne Physiker spre-chen von „Strings“, ultrafeinen Saiten im Mikro- und Makrokosmos. Aber man muss nicht den Physikern folgen, die stets zu materialistisch, martialisch – martyriell könnte man fast sagen – argumentieren. Es ist auch nicht gut nur den Geisteswissenschaftlern zu folgen, die die bedeuten-de Einheit, die sie zu beweisen trachten, schon vorher in ihr Reden verwoben haben. Sie ziehen sozusagen das Kaninchen aus dem Hut, das sie zuvor dort hineintaten. Ich empfehle das Spre-chen, das Schreiben, das Vorgehen bei seinem Vorgang selbst zu nehmen, eben die hauchdünnen Fäden von trau, treu, tran und was einem sonst noch assoziativ dazu einfällt nachzuzeichnen. Diese etymologischen oder auch rein assoziativen Wortwurzeln klingen selbst schon wie ein Formel-Wort, und man muss sich vorstellen, dass die Frühmenschen sich nur mit solchen Laut-gebilden verständigt haben.
Vor daher gesehen ist die Trauer nicht traumatisch, nicht Traufe, nicht traubig, kein Traktat und auch kein Traum. Sie ist der Treck, der Tross, der uns durchs Leben zieht. Der Triumph, denn es ist kein Widerspruch zu sagen, dass man nicht am Leben hängt und doch gerne lebt, dass man die Trauer auch genießen kann als etwas Tragendes, Sich-Fallen-Lassendes und nicht Tragisches. In ihrer Studie „Gehirn und Gedicht“ (Schrott, R., Jacobs, A., 2011) haben ein Neurowissenschaftler und ein Schriftsteller äußerst ausführlich derartige elementare Wortlaut-Verbindungen und -Verknotungen beschrieben. Sie erklären diese als unbewusste wie angeboren erscheinende Gedächtnis-Vorgänge und „prototypische Konzepte“ oder Strukturschemata, die vorgegeben erscheinen und ein tiefes unbewusstes Gedächtnis erster Prägungen enthalten. Von Trauer verstehen sie dennoch nichts. Denn die Trauer ist unsterblich.
Ich gebe zu, dass dies alles nicht immer einleuchtend erscheint. Das übliche trauern ist uns als ein persönliches unglückliches Gefühl zu bekannt, als dass man sich auf eine Art universelle tranceartige Verfassung, etwas tieffühliges Transformierendes einstellen könnte. Aber man muss sich gar nicht darauf einstellen. Ich habe Trauer nur als Anfang von allem verwendet, weil es besser ist als einen Urkanll oder einen Gott als Anfang zu unterstellen. Subjicere heißt unterstel-len, und wir sind Subjekte, unterstellt dem Unbewussten oder dem X, Y, dem Irgend und Nirgend. Es hat keinen Sinn mit A anzufangen. Man muss sich das Ur-Nichts als einen Trauerfall vorstellen, aber es ist ein Trauerfall, der glücklich macht. Warum nicht? Freilich empfehle ich, um dem Trauerglück näher zu kommen, die Übungen mit meinen Formel-Worten zu machen. Die Praxis macht einem alles klar, was ich hier nur als Theorie zusammenstottern konnte.
(Artikel wird fortgesetzt)